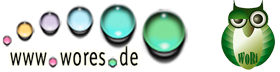Namensdeutungen
und ihre Enstehung
Allgemeines zur Deutung der Vor- und Familiennamen

Wenn wir die Bedeutung von Familiennamen verstehen wollen, ist sehr nützlich zu betrachten, auf welche Weise diese, für das Mittelalter, „neuen“ Namen entstanden. Unsere heute noch gebräuchlichen Nachnamen sind innerhalb von ca. 5-6 Jahrhunderten entstanden. Im Wesentlichen sind sie eine Errungenschaft und ein Produkt des Mittelalters.
Die Bildung von Nachnamen begann um etwa 1000 n. Chr. und endete im darauffolgenden 16. Jahrhundert. Unsere (europäischen) Nachnamen sind ein Spiegel dieser Zeit und spiegeln teils sehr direkt und deutlich die Werte der damaligen Zeit wider. Die Entstehung und letztendliche Durchsetzung der sogenannten „Zweinamigkeit“ verlief nicht ohne Grund oder zufällig.
Die Zeit um die Jahrtausendwende 900 / 1000 n. Chr. ist gleichzeitig auch der Beginn der Gründung vieler und schnell wachsender Städte. Die Einwohnerzahlen überschlugen sich teils von Jahr zu Jahr. Die Verwaltung all dieser Menschen machte es nötig, ein Werkzeug zu entwickeln, dass dabei half, Menschen schon von Geburt an vom Namen her voneinander zu unterscheiden.
Neben einigen anderen Gründen, die man eher als Modewelle der Adligen betrachten kann, ist dies der ausschlaggebende Grund für die Entstehung und Vererbung von Familiennamen. Die Zeit von 1000 – 1500 n. Chr. legt die Kriterien fest für die Art und Weise, wie Familiennamen gebildet werden. Zusammenfassend können wir sagen, dass Familiennamen sich auf Grund der folgenden fünf Kriterien bilden und sich daraufhin auch heute noch unterscheiden lassen:
Die Geschichte von Nachnamen / Familiennamen
Die Geschichte der Nachnamen / Familiennamen beginnt im frühen Mittelalter bis in das 12. Jahrhundert n. Chr. war es im Gebiet des heutigen Europas üblich, Menschen nur jeweils einen Namen zu geben. „Johann“ oder „Anna“ werden eben „einfach nur“ „Johann“ oder „Anna“ genannt. Wir wissen dies, aus den uns zahlreich zur Verfügung stehenden historischen Dokumenten: Urkunden, Kirchenbücher, Gerichtsunterlagen, Verträgen, aber auch literarischen Werken, die man als „Pulszeiger“ der damaligen Zeit ergänzend hinzunehmen darf. Ausnahme hierbei waren Titel von Herrschern und geistlichen Würdenträgern, z.B. Karl der Große, aber auch die Römer, mit ihrem Drei-Namen-System.
Doch spätestens mit Beginn des Spätmittelalters um 14 verbreitete sich ein neuer Namens-Trend in ganz Europa: nach und nach wurde werden Menschen mit zusammengesetzten Namen erwähnt. Wir sprechen hier von einer Entwicklung zur „Zweinamigkeit“. Namen bestehen nun aus mindestens zwei Bestandteilen:
Dem Rufnamen (Vornamen) und dem Beinamen oder dem Familiennamen (dem heutigen Nachnamen).
Der Rufname - Der Rufname stand meist am Anfang des Namens und bezeichnet den Teil, mit dem der Mensch bevorzugt angesprochen wurde – z. B. „Johann“.
Der Beiname - Der Beiname weist meist auf eine charakteristische Eigenschaft des Namenträgers hin, die beispielsweise zwei „Johanns“ voneinander unterschied: Johann „der Kühne“ oder Johann „der Lange“. Ein wichtiges Merkmal des Beinamens ist, dass er nicht vererbt wurde. Die Nachkommen beispielsweise von einem „Johann der Lange“, erhielten einen jeweils anderen Beinamen, der zu ihren Eigenschaften passte.
Der Familienname - Der Familienname entspricht unserem heute noch gebräuchlichen „Nachnamen“. Er wird, im Gegensatz zum oben genannten „Beinamen“, von einer Generation auf die folgende Generation übertragen. Wir können heute zusammenfassend sagen, dass sich der Familienname aus dem Beinamen entwickelt hat. Die Entwicklung, für Personennamen mehr als nur ein Wort zu verwenden, wird im Fachjargon auch als „Zweinamigkeit“ bezeichnet und dieser Entwicklung wollen wir uns nun im Detail widmen.
Was war die Ursache für den Übergang zur Zweinamigkeit?
Ein einfaches Beispiel mag die Notwendigkeit für verschiedenartigere Namen gut verdeutlichen:
Für die Stadt Köln sind uns für das 12. Jahrhundert n. Chr. 823 Träger des Namens „Heinrich“, 639 für „Hermann“ und 497 für „Dietrich“ belegt.
Dieses Beispiel bezeugt, dass die Beliebtheit einzelner Namen in den Städten des Mittelalters, zu einer großen Zahl an gleichzeitig lebenden Menschen mit demselben Namen führte. Die um diese Zeit sich weiterausbauende Verwaltung und Bürokratie stand vor dem Problem, Menschen anhand ihres Namens nicht mehr eindeutig voneinander unterscheiden zu können. Dokumente aus Verwaltung und Justiz bezeugen schriftlich, dass es nötig wurde, Menschen zumindest mit einem dem Rufnamen hinzugefügten Beinamen zu ergänzen.
Nachnamen aus Übernamen
Einige Nachnamen / Familiennamen leiten sich in ihrer Bedeutung von einer auffälligen Eigenschaft des Namensträgers ab„Übernamen“ sind solche Namen, die etwas Charakteristisches über einen Menschen bezeichnen und die nicht zu der Gruppe der Ruf-, Herkunfts-, Wohnstätten- oder Berufsnamen gehören. Übernamen beziehen sich daher auf körperliche, geistige, charakterliche Merkmale und auf aussagekräftige Ereignisse in der Lebensgeschichte eines Menschen. Wir können 15 Gruppen unterscheiden, aus denen die heute noch bekannten Übernamen gebildet wurden:
- Körperliche Eigenschaften, Körperteile (Jung, Haupt)
- Eigenschaften des Geistes und Charakters (grimmig, froh)
- Tiere, Körperteile von Tieren (Stier, Pagenstert‚ Pferdeschwanz)
- Pflanzen, ihre Teile und Früchte (Pilz, Holzapfel)
- Gegenstände (Korb, Stock, Stiefel)
- Gestirne, Naturerscheinungen (Stern, Schnee)
- Jahres- und Tageszeiten, Monate und Wochentage, Festtage (Herbst, Hornung‚ Februar)
- Kirchliches (Weihrauch, Teufel)
- Geld und Geldeswert (Schilling, Pfund, Taler)
- Besitz (Armmann, Nothaft)
- Gelegentliche oder gewohnheitsmäßige Handlungen (Tanz, Quenzer, Kartenspieler)
- Abstammung, Verwandtschaft u. ä. (Trautvetter, lieber Vaterbruder, Stiefvater)
- Weltliche und geistliche Würdenträger (Fürst, Probst, Graf)
- Reihenfolge (Zwölfer, Erster)
- Vorstellungen des Volksglaubens (Neidnagel)
Wie kam ein Mensch zu seinem Übernamen?
In den Übernamen spiegeln sich zum großen Teil ästhetische und moralische Normvorstellungen wider, die zu der Zeit der Namensbildung für die „Namensgeber“ galten. Man kann heute sagen, dass die Entwicklung unserer Nachnamen mit dem Mittelalter begann und spätestens mit der Renaissance endete – 1000 bis 1600 n. Chr. Damit sind unsere Nachnamen / Familiennamen ein Spiegel dieser Zeit. Übernamen erfüllten zu der Zeit, wo sie noch „jung“ waren, eine Art sozialer Kontrolle. Menschen die durch z.B. negativ bewertete Eigenschaften auffielen, erhielten mit ihrem Übernamen eine Art Stempel – Warnung und Kennzeichen zugleich für den Namensträger, wie auch für die Mitmenschen. Beispiele hierfür sind:
- „Hahn“ für einen arroganten und/oder streitsüchtigen Menschen
- „Wunderlich“ für den Sonderbaren oder Launischen
- „Klump“ für den Dicken oder grobschlächtigen Menschen
Häufig sind zwar negative Bezeichnungen, aber in fast gleichem Maße gibt es auch positive Übernamen oder zumindest neutrale wirkende. Beispiele für positive oder gar schmeichelnde Übernamen sind:
- „Frühauf, Morgenschweiß, -roth“ für den Frühaufsteher
- „Schöne, Schönemann, Schönherr“ für den Gutaussehenden
Beachten muss man allerdings eines: im Mittelalter hatten viele heute noch gebräuchliche Wörter eine andere Bedeutung als heute. Der Nachname „Bös(e)“ hatte zu jener Zeit als Übername die Bedeutung von „niederem Stand, schwach“. „Kluge“ konnte auch „zierlich, tapfer, listig“ bedeuten. Und der „Stark(e)“ war ursprünglich der Übername für einen „schlimmen, herrschsüchtigen“ Menschen. Zusammenfassend können wir Übernamen in die folgenden Kategorien einsortieren:
- Körpergröße und –form
- Körperteile und -Auffälligkeiten
- Charakter und Verhalten
- Essen, Trinken
- Kleidung
- Lebensgeschichte
Nachnamen aus Berufsbezeichnungen
Einige Nachnamen / Familiennamen leiten sich in ihrer Bedeutung von der mittelalterlichen Berufsbezeichnung des Namensträgers abAuf dem Land bilden sich solche Familiennamen entweder kaum oder in nur Differenzierung: Bauer, Müller, Schmied, Schäfer sind hier die wenigen und klassischen Beispiele. Auf dem Land ist die Arbeitsteilung eher gering, was sich gleichzeitig in den nur wenigen aber vieles umfassenden Berufsbezeichnungen ausdrückt.
Ganz anders ist hier aber die Entwicklung in den Städten. Hier explodiert gerade die Arbeitsteilung. Die rasche Entwicklung des Handwerks, des Handles, der Wirtschaft und auch der Technik, erfordern geradezu berufliche Spezialisierungen in allen der genannten Bereiche. Die Handwerks-Zünfte trieben die Arbeitsteilung und Spezialisierung noch weiter voran, indem sie etliche „Berufsklassen“ schufen. Arbeiter dieser Berufsklassen durften dann auch nur eine ganz bestimmte Tätigkeit ausüben: der „Mehlmann“ durfte nur ausschließlich Mehl verkaufen, der „Salzmann Salz“. Der „Eppler“ dürfte nur ausschließlich Äpfel verkaufen und der „Erbser“ Erbsen. Der „Löffler“ durfte nur ausschließlich Löffel herstellen und der „Messerschmidt“ Messer.
In größeren Städten wie Frankfurt, Heidelberg oder Wien sind für das Jahr 1440 mindestens 140 solcher Berufszweige belegt. Diese Entwicklung drückt sich auch in den Familiennamen aus, die in der Zeit 14. – 16. Jahrhundert in den Städten entstehen.
Es entstehen Familiennamen, die sich direkt auf den ausgeübten Beruf beziehen und solche, die sich indirekt darauf beziehen. Die indirekten Berufsnamen beziehen sich dann auf eine bestimmte Auffälligkeit an der Art, wie der Benannte seinen Beruf ausübt – diese Berufsnamen sind aber eher selten und zum anderen von einer anderen Gruppe der Familiennamensbildung (Familiennamen aus Übernamen) nur schwer zu unterscheiden. Es lassen sich die folgenden 10 Klassen von Berufsnamen unterscheiden, die zu Familiennamen geführt haben (in „Klammern“ finden Sie eine Auswahl von Original-Berufsbezeichnungen, von denen die Berufsnamen abgeleitet wurden):
- Landwirtschaftliche Berufe (z.B. Fischer, Bauer, Schäfer, Koler, Vogler)
- Nahrungsmittelgewerbe (z.B. Beck (Bäcker), Müller, Metzler, Fleischmann, Lebkuchner)
- Metallverarbeitung (z.B. Schmied, Schlosser, Keßler, Plattner, Kandelgießer, Gürtler)
- Holzverarbeitung (z.B. Wagner, Büttner, Schreiner, Zimmermann, Küfer)
- Ledererzeugung (z.B. Schuster, Sattler, Lederer, Gerber, Peutler)
- Textil- und Pelzgewerbe (z.B. Schneider, Huter, Kürsner, Weber, Färber, Tuchscherer)
- Bauwesen (z.B. Maurer, Ziegler, Steinmetz, Decker, Schifferdecker, Pflasterer, Strohschneider)
- Dienstleistungen (z.B. Bader, Fuhrmann, Kerner, Barbier, Scherer, Schreiber, Schroter, Arzt, Stubenwascher)
- Ämter (z.B. Schultheiß, Schulze, Meyer, Hofmann, Kellner, Forster, Vogt, Falkner, Thurner, Holzwart, Verlieser)
- Sonstige Berufe (z.B. Sailer, Hafner, Maler, Kramer, Glaser, Schüssler, Pfeiffer, Pantoffelmacher, Bürstenbinder)
Nachnamen nach der Wohnstätte
Einige Nachnamen / Familiennamen leiten sich in ihrer Bedeutung vom Wohnort des Namensträgers ab Nachnamen die sich von der Wohnstätte ableiten, sind leicht zu verwechseln mit denen, die sich von der Herkunft ableiten. Dennoch lassen sich beide Arten deutlich voneinander unterscheiden und ihre Entstehungsgeschichten weichen stark voneinander ab. Familiennamen die sich von der Herkunft ableiten, galten Fremden, Menschen die insbesondere in den Städten sich ansiedelten und sich durch ihre Herkunft von den Einheimischen und anderen Zugezogenen unterschieden. Familiennamen die sich von der Wohnstätte her ableiten, galten hauptsächlich Einheimischen.
Auf welche Arten von Wohnstätten beziehen sich solche Familiennamen?
Für diesen Fall der Familiennamen-Bildung kamen hauptsächlich:
- Hof-Namen und
- Geographische Namen
in Betracht. Hof-Namen: Besonders beim Adel war diese Art der Familiennamen sehr beliebt. Sie kennzeichneten damit repräsentativ die Zugehörigkeit Ihrer Familie zu ihrem Hof, dem geographischen Stammbesitz. Geographische Namen: Hierfür konnte jede geographische Auffälligkeit in Frage kommen – Berge, Flüsse, Täler, Seen. Insbesondere Flurnamen sind hier oftmals Pate für eine Unzahl an, von ihnen abgeleiteten Familiennamen. Beispiele hierfür sind:
- Flurname: „Breite“ (‚offene Flur‘) – Familienname: „Breitner, Breiter“
- Flurname: „Vogelsang“ (Ort mit viel Vogelgesang) – Familienname: „Vogelsang, Voglsang, Fuglsang“
- Flurname: Im Ried (‚Schilfgegend‘) – Familienname: „Ried, Riedel, Rieder, Riedermann, Zried“
Die Menschen nutzen solche bekannten Begriffe um ihren Familiennamen davon abzuleiten und ihren Wohnort zu kennzeichnen. Im Gegensatz zu der Ableitung von Hof-Namen, verfolgte die geographische Namensbildung vielmehr praktische Zwecke und weniger repräsentative. Der Name war zugleich Wegweiser zum Wohnort des so Benannten. Historisch haben sich die folgenden drei Richtungen in der Bildung von Familiennamen aus der Wohnstätte herausgebildet: Unterschieden wurde zwischen:
- Der Oberflächengestalt der Landschaft: Bodenerhebungen, Senken, Täler, Gewässer, Sümpfe
- Lage, Form, Qualität des Landes, Richtungsangaben, Himmelsrichtungen, Lichtverhältnisse
- Von Menschen geschaffenen Auffälligkeiten: Felder, Wiesen, Zäune, Wege, aber auch Bauten wie: Türme, Mauern, Friedhöfe, Gärten
Insbesondere auf dem Land und in den räumlich offeneren Gebieten verbreitet sich die Benennung nach der Wohnstätte besonders stark. Hingegen in den Städten nur sehr wenig. In den Städten lebten die Menschen sehr gedrängt beieinander und jede geographische Besonderheit betraf gleichsam mehrere Menschen. Somit machte es in den Städten mehr Sinn, nach anderen Kriterien für die Bildung von Familiennamen Ausschau zu halten.
Nachnamen nach Herkunft
Einige Nachnamen / Familiennamen leiten sich in ihrer Bedeutung von der Herkunft des Namensträgers abWie bereits erwähnt, ist findet zur Zeit des 13. und 14. Jahrhunderts eine starke Binnenwanderung statt. Die Städte wirken wie Magneten auf unzählige Menschen, deren Attraktivität im Vergleich zum Landleben, sie anzieht. Die Städte wachsen in kürzester Zeit an der Anzahl ihrer Bewohner. Damit nimmt auch die Notwendigkeit zu, Menschen mit ihrem Namen zu unterscheiden. Mit nur einem Namen, dem gewohnten Namenssystem wird dies sehr bald unmöglich, da es in recht kurzer Zeit zu viele Menschen gleichen Namens gibt.
In den Städten ist zu beobachten, dass die Menschen zuerst beginnen, sich nach ihrer Herkunft namentlich von einander zu unterscheiden. Gerade die Herkunft ist das, was die aus allen Teilen Europas zugezogenen Menschen in den schnellwachsenden Städten am meisten unterscheidet. In der Frage der „Herkunft“ unterscheiden die Menschen in der Wahl des Nachnamens hauptsächlich zwischen den beiden folgenden Kriterien:
- Der Herkunfts-Ort; z.B. Hamburg, Berlin, Mecklenburg
- Das Herkunfts-Volk / -Land; z.B. Ungarn, England, Sachse, Bayer, Slaven
Es werden Nachnamen gebildet, die direkten Bezug z. B. auf den Herkunftsort nehmen. So nannte man einen aus Bayern zugezogenen Peter – „Peter der Bayer“ und wenig später nur noch kurz „Peter Bayer“. Die in den Städten gesprochenen regional abweichenden Dialekte, führten zu einer teils mannigfachen Schreibweise von Nachnamen, die auf denselben Ort verweisen. Beispiel: Für einen Menschen, der aus Köln stammte, konnten sich die folgenden Varianten für seinen Nachnamen herausbilden: „Köllner, von Cölln, Kölsch, Kölling, Cölnermann“.
Die Bildung von Nachnamen / Familiennamen aus Rufnamen (Patronymika)
Einige Nachnamen / Familiennamen leiten sich in ihrer Bedeutung von Rufnamen ab. Der Fachbegriff für Familiennamen aus Rufnamen lautet „Patronymika“ – von „Patro“ (Vater) abgeleitet. Damit ist auch gleich ein ganz wichtiges Merkmal formuliert: in der Mehrzahl gehen die europäischen Familiennamen, die aus Rufnamen entstanden, auf männliche Personen zurück. Zusammenfassend können wir sagen, dass Familiennamen die aus Rufnamen gebildet wurden, das Verhältnis einer Person zu einer anderen Person kennzeichnen. In der Tradition dieser Familiennamen sind es meist Väter auf die sie sich beziehen und weniger die Mütter. Das hat vor allem mit der untergeordneten Stellung der europäischen Frau im Mittelalter zu tun. Neben Eltern, können sich Rufnamen aber auch auf andere Personen beziehen. So gibt es historische Belege dafür, dass es teils schon genügt, wenn eine Person längere Zeit bei einer anderen Person lebte – sei es ein anderer Verwandter oder ein Lehrmeister oder eine ganze andere Person.
Auf welche Art werden Familiennamen aus Rufnamen gebildet?
Hierfür unterscheiden wir die folgenden sechs Arten:
- Durch die Verbindung mit Wörtern die „der Sohn / die Tochter von …“ bedeuten. Ein bis heute noch deutliches Indiz hierfür kennen wir aus den skandinavischen Ländern und Island. Familiennamen die sich hierbei auf eine männliche Person beziehen, enden mit –son oder –sen, solche die sich auf weibliche Personen beziehen enden auf –dottir. Aus dem Irischen kennen wir die Vorsilbe „Mac“ die den Bezug auf eine andere männliche Person bezeichnet. Im Irischen haben sich im Laufe der Zeit Nahmen aus dieser Kombination entwickelt, die nur noch entfernt, an diese „Verwandtschaft“ erinnern: so wurde beispielsweise aus „MacPhail“ => „Quail“.
- Durch Genitiv-Setzung des Rufnamens Beispiel: Aus Hans, dem Sohn von Peter wird kurzum Hans „Peters“. Im deutschen wie auch im englischen Sprachraum finden wir viele Beispiele für diese Namensveränderung. Es sind dabei immer die beiden Endungen „-s“ und „-en“ die hier Verwendung finden und den Genitiv deutlich anzeigen.
- Durch die Verbindung mit Präpositionen Beispiel: aus Maria, der Tochter von Francesco wird „Maria de Francesco“. „de“ ist hierbei eine Präposition, aus dem Spanischen. Das italienische Äquivalent hierzu lautet „di“, z.B. in „di Martin“; das albanische Äquivalent lautet „e“.
- Durch die Verwendung von Suffixen Suffixe sind in diesem Fall Endungen, die übersetzt so viel bedeuten wie „zugehörig zu“ / „Sohn/Tochter des/der …“. Besonders auffällige Beispiele kennen wir hier aus dem slawischen Sprachraum. Aus dem Tschechischen sind uns der Suffixe „-owski, -ewski, -inski“ für männliche Bezugsverhältnisse bekannt; „-owa“ kennzeichnet dagegen ein weibliches Bezugsverhältnis. Im Russischen werden dem Vaternamen die Suffixe „-owitsch, -ewitsch“ und „-itsch“ angehängt. Im Deutschen stehen hierfür stellvertretend die Suffixe „-er, ing, mann“.
- Durch Verkleinerungs-Suffixe. Gemeint sie hiermit Suffixe, die als Koseformen für den jeweiligen Rufnamen verwendet wurden oder die dazu verwendet wurden, den Junior nach dem Senior zu benennen, auf Grundlage des selben Rufnamens. So wird der Junior von einem „Hein“ beispielsweise „Heinle“ oder „Heinlein“ genannt. Aus dem Italienischen sind uns die folgenden Diminutiv-Suffixe (Verkleinerungs-Suffixe) überliefert: Albert „-ello, -etto, -etti, -ino, -ini, -oni, -otti, -otto“.
- Durch unveränderte Zusammenstellung. Der Rufname des Vaters, wird dem Rufnamen des Sohn / der Tochter unverändert angehängt. Beispiel: Heinz Andre, Marie Theodor. Diese Variante der Bildung von Familienamen aus Rufnamen erinnert sehr stark an die auch heute noch gebräuchliche Verwendung von Doppel-Vornamen.